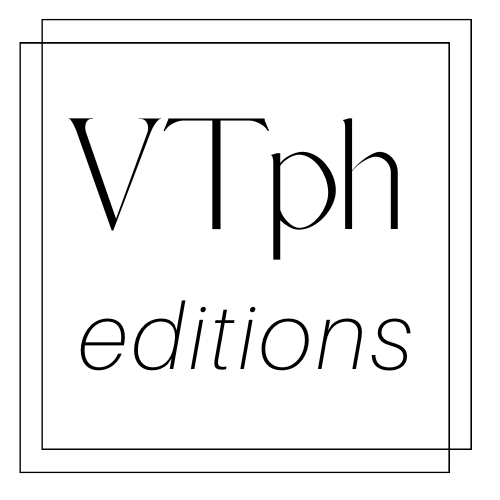INTERVIEW // Max Dax im Gespräch mit Armin Linke
Max Dax: Armin Linke, drei Mal haben wir unser Gespräch verschieben müssen. Statt in Turin oder Mailand treffen wir uns jetzt hier bei Ihnen in Ihrem Berliner Atelier. Sie scheinen viel unterwegs zu sein.
Armin Linke: Es wird immer schwieriger, Nein zu sagen. Mein neuestes Projekt führt mich abermals rund um die Welt. Die TBA21 Foundation hat mich beauftragt zu dokumentieren, wie die Ozeanforscher ihrer Arbeit nachgehen. Die erste Reise führte mich diesen Sommer nach Kingston, Jamaika. Dort hat die International Seabed Authority ihren Sitz. Es handelt sich dabei um eine UN-Institution, die in den Achtzigerjahren gegründet wurde, um den Meeresgrund der internationalen Gewässer — genannt „Area“ — zu verwalten. Es handelt sich hierbei um jene Großbereiche der Ozeane, die über 300 Seemeilen von den nächstliegenden Staaten oder Inseln entfernt sind. Die Institution befasst sich mit der Frage, wie in solchen Gewässern Deep Sea Mining, also Bergbau in der Tiefsee betrieben werden kann. Das spezielle Problem beim Tiefseebergbau ist, dass nur die reichsten Nationen über die hierfür notwendige Technologie verfügen, der Boden aber anteilig eigentlich allen gehört. Eine wichtige Frage lautet also, nach welchem Schlüssel die Gewinne aus solchen Unternehmungen an Entwicklungsstaaten verteilt werden. Die UN bezeichnet die Bodenschätze, die unter den Ozeanen liegen, nämlich als „common heritage of mankind“. Dieser Begriff umfasst übrigens nicht nur die Bodenschätze. Derzeit wird debattiert, ob dies nicht auch noch all die Mikroben und Lebewesen einbeziehen sollte, die man im Zuge der Tiefseeforschung noch so findet, und deren DNA theoretisch patentierbar ist. Auch hier lautet die Frage, wem gehört dieses Erbgut, wenn man damit beabsichtigt Gewinne zu erwirtschaften.
Das sind interessante juristische und vielleicht sogar menschheitsrelevante Fragen. Was aber hat das alles mit Fotografie zu tun?
Mit meiner Fotografie versuche ich zu untersuchen, wie wir gemeinsam und unterschiedlich durch Bilder die Welt begreifen. Und zum Begreifen der Welt gehört zunehmend das Verständnis, dass man vor allem auch das Unsichtbare hinter der Oberfläche begreifen muss — ob es sich nun um die Oberfläche des Meeres oder die Fassade eines Hauses handelt, hinter dessen Mauern weltverändernde Entscheidungen getroffen werden. So gesehen können Bilder von Wellen oder einer verspiegelten Häuserfassade Indizien sein, obwohl sie nur das Sichtbare zeigen.
In Mailand ist kürzlich Ihre neueste Ausstellung zu Ende gegangen, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Sie trug den Titel „The Appearance of That Which Cannot be Seen“ und dreht sich um genau das: Die Erscheinung dessen, das nicht gesehen werden kann. Dazu haben Sie auch einen Katalog veröffentlicht.
Mein Fotoarchiv hat eine kritische Masse erreicht. Ich reise und fotografiere unterwegs und bin mir zugleich dessen bewusst, dass ich doch nur stets einen Bruchteil des Gesehenen zu dokumentieren imstande bin. Ich bin zunehmend daran interessiert, wie andere Menschen, die auch nach Formen suchen, diese Bilder lesen. Es ist gewissermaßen der zweite Schritt. Es ist ein Versuch, die Welt durch das Objektiv der Kamera zu lesen — und anschließend lesen andere Menschen meine Lesart. Und da knüpft sich natürlich gleich die nächste Frage an, nämlich wie Bilder generell gelesen werden.
Ihr Bildarchiv umfasst mittlerweile eine halbe Million Bilder.
Dabei geht es vorrangig gar nicht um mein Archiv. Ich habe in der Vergangenheit mit verschiedenen kuratorischen Kollektiven Bildarchive ausgewertet, oder besser: aktiviert. Zum Beispiel gab es ein gemeinsames Projekt mit Doreen Mende und Estelle Blaschke unter dem Titel „Doppelte Ökonomien — Vom Lesen eines Fotoarchivs aus der DDR (1967-1990)“. Da haben wir das Archiv eines DDR-Industriefotografen gesichtet und versucht zu verstehen, wie Designgeschichte, wie Ökonomie und Diplomatie in diesem Staat funktioniert haben. Und vor zwei Jahren haben Doreen Mende, Milica Tomić und ich unter dem Titel „Travelling Communiqué“ das zeremonielle Fotoarchiv von Tito gesichtet und eine Auswahl der darin gefundenen Bilder im Museum für Jugoslawische Geschichte (Museum of Yugoslav History) in Belgrad ausgestellt. Dieses umfangreiche Archiv umfasste ausschließlich Bilder von fünf verschiedenen Fotografen, die allesamt politische Zeremonien abgelichtet haben. Jugoslawien stand ja wie Indien zwischen den Blöcken, war Teil des „Non-Aligned Movements“. Die Fotografien dieser Zeremonien sind deshalb so aussagekräftig, weil sie vielleicht so etwas wie einen möglichen dritten Weg zwischen den zwei Ideologien des Kalten Kriegs darstellen bzw. zelebrieren. Und genau diese Methode des Sichtens habe ich mit „The Appearance of That Which Cannot be Seen“ auf mein eigenes Archiv angewendet.
Sie haben sieben Kuratoren auf Ihr Archiv angesetzt.
Eigentlich sind es keine Kuratoren, ich nenne sie Experten oder auch Akteure. Aber vielleicht wurden sie im Laufe des Sichtungsprozesses tatsächlich zu welchen. Der erste war der französische Soziologe, Wissenschaftsanthropologe und Philosoph Bruno Latour. Er hat mich gefragt, ob er für seine Website „Modes of Existence“ Bilder aus meinem Archiv auswählen dürfe. Für mich war diese Bitte sehr lehrreich. Er hat Zusammenstellungen von Bildern gemacht, auf die ich nie gekommen wäre. Er hat auch Zusammenhänge gesehen, die sich mir erst durch seine Herangehensweise erschlossen haben. Generell könnte man also sagen, dass es in meiner Arbeit nicht zuletzt darum geht, wie und mit welcher Technik wir die Welt lesen können bzw. die Bilder von der Welt. Wir müssen eine Grammatik der Bilder lernen, um beispielsweise Bilder, die wir über die Medien zu sehen bekommen, lesen und dechiffrieren zu können. Man muss imstande sein das Verborgene hinter den Bildern zu lesen, um dann Entscheidungen treffen zu können. Die Namen der anderen sechs Kuratoren lauten Jan Zalasiewicz, Peter Weibel, Ariella Azoulay, Mark Wigley, Lorraine Daston und Franco Farinelli.
Im Katalog zu „The Appearance of That Which Cannot be Seen“ finden sich auch zwei Fotos von Hans Ulrich Obrists Berliner Archiv in der Nähe der Charité. Sie zeigen bis an die Decke der Zimmer getürmte Stapel von Bananenkisten, die wiederum gefüllt sind mit Kunstbüchern und –katalogen. Waren Sie von der Asymmetrie dieses Archivs fasziniert? Oder weshalb tauchen auch solche „Beweisfotos“ in Ihrem Katalog auf?
Hans Ulrich Obrist — oder sollte ich sagen: das System HUO? — hat in Berlin eine große Wohnung, die er ausschließlich als Archiv benutzt. Dieses Bananenkarton-Prinzip hat übrigens System. Es sieht alles sehr durcheinander aus, aber wenn Sie Hans Ulrich fragen, wo sich etwa eine Teetasse von Cedric Price befindet, so weiß er stets die Bananenkiste. Das Archiv funktioniert also.
Es funktioniert, wenn Obrist physisch anwesend ist. Interessanterweise habe ich mein erstes Interview mit ihm eben dort geführt. Ein schöner, vollgestellter Ort.
Es gibt viele verschiedene Arten von Archiven. Einige sind eher passiv angelegt, dass jeder dazu Autorisierte Wissenschaftler Daten einsehen kann. Andere Archive sind explizit als aktive Orte der Wissensvermehrung gedacht, in denen neue Sprachen des Wissens entwickelt werden sollen. Eines meiner Fotos im Katalog zeigt den Serverraum des Klimarechenzentrums in Hamburg. Dort werden die globalen Klimadaten digitalisiert aufbewahrt. Alle fünf Jahre übrigens werden die Hochleistungsrechner ausgewechselt, weil es ökonomischer ist, neue, leistungsfähigere Rechner zu kaufen, als die alten weiter zu betreiben. Mit jeder neuen Rechnergeneration verringern sich die immensen Stromkosten drastisch. Mittlerweile ist man bei etwa zwei Millionen Euro Stromkosten pro Jahr angelangt. Man kann sich also vielleicht vorstellen, wie datenintensiv dieses Archiv ist. Und wie abhängig von ununterbrochener Stromzufuhr, denn die Daten müssen permanent gekühlt werden.
Ein anderes Bild von Ihnen zeigt ein ganz anderes Archiv: In Bangladesch werden tausende verschiedene Sorten Reis in Tongefäßen aufbewahrt. Es handelt sich also um ein Weltarchiv des Reises.
Hier handelt es sich um eine Initiative namens Nayakrishi Andalon. Hier haben sich Bauern organisiert, Reissamen aus der Tradition aufzubewahren, weil von den ursprünglich vielleicht 10.000 verschiedenen Reissorten nur noch zwanzig oder dreißig industriell genutzt werden. Aus der Vielfalt ist durch die Industrialisierung ein Monokultur geworden. Den Bauern ist es gelungen, von diesen ehemals 10.000 Sorten immerhin an die 7.000 zu bewahren. Anders als das wie eine Bank gesicherte genetische Saatgutlager nördlich des Polarkreises in Norwegen allerdings, in dem Millionen verschiedener Samen aufbewahrt werden, ist das Reisarchiv zugänglich. Bauern können sich aus dem Archiv von Nayakrishi Andalon Saatgut ausleihen, verpflichten sich damit aber zugleich, am Ende des Jahres die doppelte Menge an Reis zurückzugeben. Es handelt sich also um ein aktives Archiv. Politische und juristische Fragen knüpfen sich an solche Bilder an. Wer darf auf das Weltwissen zugreifen? Wer darf damit Geld verdienen?
Haben Sie den Stollen, den Svalbard Global Seed Vault auf Spitzbergen, eigentlich auch schon fotografiert? Im Katalog findet sich kein Foto.
Leider noch nicht, aber der Stollen steht tatsächlich ganz weit oben auf meiner Wunschliste. Meine Arbeit besteht aus verschiedenen Wunschlisten mit Orten und Plätzen, die einer nach dem anderen abgearbeitet und durchfotografiert werden.
Diese Wunschzettel bestimmen also ein ums andere Mal, wohin Sie reisen?
Genau. Im Moment etwa wachsen meine Wunschlisten fast täglich in Bezug auf Unterwasserziele. Das hängt mit dem bereits eingangs erwähnten neuen Projekt über die Ozeane zusammen. Damit beschäftige ich mich gerade intensiv, und mit ähnlicher Intensität wachsen diese Listen.
Schießen Sie die Unterwasserbilder selbst?!
Nein, hier greife ich vor allem auf Videos von deutschen, aber auch amerikanischen Instituten zurück, die Unterwasserdrohnen aus der Tiefsee liefern. Anfang 2017 werde ich mich für eine Woche in ein solches Videoarchiv begeben und die ganzen Filme dort versuchen zu sichten. Ziel ist, aus diesen wissenschaftlichen Videos Sequenzen auszuwählen, die eine echte Aussagekraft haben. Die Videos und Bilder werden von sogenannten Remote Observing Vehicles geliefert, die eine neue Bildästhetik aufweisen. Ich finde es interessant, auch diese Ästhetik zu untersuchen, während die Meeresbiologen ja in erster Linie herauszufinden versuchen, was für und wie viele Tiere in sechs oder sieben tausend Metern leben. Das alles ist bis heute noch überraschend unerforscht.
Wie wählen Sie die Bilder oder Sequenzen aus, wenn Sie selbst gar kein Wissenschaftler sind?
Ich wähle primär nach ästhetischen Gesichtspunkten aus, gleiche dann aber meine Selektionen mit den Meeresbiologen ab und lasse mir erklären, was genau diese Sequenzen zeigen. Und damit gehen wir natürlich einen anderen Weg als den Pfad des Spektakulären. Das sind ja nicht immer atemberaubende Bilder, wie wir sie aus Zeitschriften wie National Geographic kennen, sondern es sind teilweise auf den ersten Blick sehr unspektakulär wirkende, und trotzdem in ihrer medialen Wichtigkeit aussagekräftige Bilder — wenn man sich für die Informationen hinter dem Bild interessiert.
Wie können öde Bilder gute Bilder sein?
John Herschel gilt als einer der Erfinder der Fotografie. Er machte wissenschaftliche Aufnahmen von Sonnenstürmen. Im Zuge seiner fotografischen Experimente erfand er das Fotonegativ. Seine Bilder sind natürlich wichtig, jenseits der Frage, ob das auf seinen Fotos sichtbare nun „schön“ oder „nicht so schön“ ist.
In Ihrem Katalog finden sich tatsächlich auch ohne dunkle Unterwasserfotos viele unscheinbare Bilder. Es handelt sich durchweg um codierte Bilder, und Sie benutzen erklärende Kurztexte, mithilfe derer Sie die Fotos kontextualisieren.
Genau. Und zugleich weiß ich, dass man die Welt gar nicht katalogisieren kann, dass die Idee einer visuellen Weltformel nichts anderes als eine Illusion ist. Ich fotografiere stets nur die Oberfläche. Das Dahinter kommt tatsächlich meistens erst nachher und fast ausschließlich im Dialog mit den Institutionen oder mit dem Ort, an dem ich mich aufhalte. Ich verhalte und fotografiere eben nicht wie ein Reporter, der ein Bild zu stehlen versucht. Ich fotografiere vielmehr das, was mir gezeigt wird oder was ich auf meinen Spaziergängen sehe. Diese Spaziergänge unternehme ich nie alleine, sondern stets mit jemandem, der sich vor Ort auskennt,.
In Ihrem bisher erfolgreichsten Buch, „Transient“, gibt es überdurchschnittlich viele Beispiele von totaler Schönheit, die Sie in ihren Fotos eingefangen haben. Ich erinnere nur an den Drei-Schluchten-Staudamm, den Sie wie ein Weltwunder — wie die Pyramiden von Gizeh — eingefangen haben.
Aber auch da war ich „embedded“, wurde ich herumgeführt. Das Faszinierende an dem von Ihnen genannten Drei-Schluchten-Damm ist ja, dass es sich um einen mindestens doppeldeutigen Ort handelt. So ein Wasserdamm ist vielleicht die „schönste“ denkbare Land Art. Gleichzeitig hat die Fertigstellung eines solchen Mammutbauwerks erhebliche Konsequenzen für Umwelt und Mensch. In China mussten mehr als zwei Millionen Menschen umgesiedelt werden. Und mit ihnen die Schulen, Krankenhäuser, ganze Industrien. Ganz zu schweigen von den Menschen selbst, die nicht nur ihrer Heimat beraubt werden, sondern die sich, angekommen in der neuen Heimat, umschulen lassen müssen, weil dort ihr Beruf gar nicht mehr benötigt wird. So ein Riesenprojekt hat natürlich psychologische, ökonomische und soziale Konsequenzen und führt zu erheblichen Verwerfungen. Diese Konsequenzen sieht man meinem Bild natürlich nicht an. Man „sieht“ sie erst, wenn darüber gesprochen wird oder erklärende Hintergrundtexte beigesteuert werden.
Amerikanische und Kanadische Klimawissenschaftler sichern derzeit auf eigene Faust die Daten des Weltklimas, weil sie befürchten, dass die Trump-Administration die Daten löschen könnte. So ein rigoroser Schritt könnte auch jedem digitalen fotografischen Archiv blühen, wenn man nicht aufpasst.
Die besten Archivierungsmedien sind grundsätzlich nach wie vor physische Medien — wie das Buch, das Fotonegativ oder die Vinylschallplatte. Diese Medien überdauern Jahrhunderte. Digitalen Bildern droht ja nicht nur der Kurzschluss der Festplatten, auf denen sie gespeichert sind. Ich arbeite zur Zeit mit dem italienischen Paparazzo Corrado Calvo an einem Buch über dessen fotografisches Archiv von einigen Hunderttausend Fotos. Er hat über Jahrzehnte auf Sardinien die Körper am Strand, diese öffentlichen Räume fotografiert. Damit hat er einen immens wertvollen Werkkörper geschaffen, der vor allem im Rückblick an Wert gewinnen wird, um zu verstehen wie wir in unserer Gesellschaft mit dem Körper umgehen. Ich fragte ihn, ob er auch Fotografien jüngeren Datums habe, also digitale Bilder aus den letzten sechs Jahren. Und er antwortete mir, dass er einmal keinen Platz mehr auf seiner Festplatte gehabt hätte — also habe er Tausende von Bildern gelöscht um Platz zu schaffen. Jedes Handy, das kaputt geht, steht potenziell für den Verlust des fotografischen Gedächtnisses eines Menschen. Da stellt sich schnell die Frage, ob man ein Fotonegativ auch so leicht verlieren würde? Festplatten gehen hingegen nach einer gewissen Zeit kaputt, oder die Daten lassen sich nicht mehr migrieren. Ich spreche davon, dass nicht materielle Daten von uns Menschen offenbar anders behandelt werden als haptisch greifbare Dinge.
Sehen Sie Ihre Fotografie als Ihren Beitrag die Menschheit zu retten?
Nein. Aber vielleicht trägt meine Fotografie dazu bei, einige Prozesse besser zu verorten, die als abstrakt gelten in der Ökonomie oder generell in der Planung der Infrastrukturen. Ich war letztes Jahr gemeinsam mit Giulia Bruno im Rahmen des Anthropozän-Projekts in Paris, wo wir die UN-Klimakonferenz COP 21 besuchten. Aus anthropologischer Neugier besuchten und filmten wir auch eine Pressekonferenz der sogenannten Climatosceptiques — das sind die Leugner des Klimawandels.
Hätten Sie sich da vorstellen können, dass deren Meinung keine zwei Jahre später die offizielle Regierungslinie der Vereinigten Staaten sein würde?
Nein, ganz und gar nicht. Wir empfanden die gesamte Veranstaltung als absurd und waren der Überzeugung, dass mit der Verabschiedung des Weltklimavertrags die Weichen in die richtige Richtung gestellt worden wären. Und wer ist jetzt Direktor der US-Umweltbehörde EPA? Scott Pruitt, einer dieser Klimaskeptiker. So schnell kann sich alles ändern. Ich finde es wichtig nachvollziehen zu können was wo wann passiert ist. Und zwar nicht journalistisch, sondern mit dem Blick eines Historienmalers — nur eben nicht gemalt.
Hat sich Ihr Blick auf die Menschen und die Menschheit durch Ihre Arbeit und durch Ihre Reisen geändert?
Nein, nicht wirklich. Aber natürlich sehe ich, dass sich gewisse Patterns wiederholen. Besonders überrascht bin ich eigentlich vor allem stets über ein und dieselbe Erkenntnis: Egal, wohin ich reise, treffe ich auf Menschen, für die vor Ort und in ihrer Welt ganz, ganz nah an der Quelle von einem Phänomen sitzen. Ein Umweltproblem, das ich fotografiere, mag weit entfernt sein von Berlin, aber für die Menschen vor Ort ist es stets unmittelbar. Deshalb ist es ja auch für meine Bilder immer sehr wichtig, stets eine Art Virgilio zu haben — Dantes Führer, der einen durch den Limbo eskortieren und den jeweiligen Ort aus der lokalen Perspektive erklären kann. Ohne diesen Virgilio wäre ich stets der Gefahr ausgesetzt, das, was ich sehe, aus dem Blickwinkel des Touristen zu sehen.
Sie brauchen die Aufklärung vor dem Bild?
Absolut. Ich muss über den Ort, an dem ich mich befinde, von einem Ortskundigen aufgeklärt werden. Es bedarf gewissermaßen einer Impfung gegen die Oberflächlichkeit des Pittoresken, das mich stets auch an einem Ort erwartet. Mit einem örtlichen Führer zu arbeiten folgt also gewissermaßen einer Methodik.
Ihnen geht es nicht um das spektakuläre Bild, sondern um das forensische Bild?
Gute Frage. Ich will Bilder, die zugleich etwas dokumentieren, wie sie Teil einer größeren Narration sind. Forensisch werden sie erst im Nachhinein, wenn jemand sich die Mühe macht, die Bilder nicht nur losgelöst voneinander zu betrachten sondern sie in einen größeren Kontext setzt. Meine Bilder hätten dann die Rolle von Indizien, die erst in der richtigen Zusammenstellung eine gewisse Aussage haben.
Wie gehen Sie mit dem Umstand um, dass Sie eigentlich gar nicht permanent um die Welt reisen müssten, um diese Beweisführung zu liefern. Allein im Umkreis der beiden Städte, die Ihren Lebensmittelpunkt ausmachen, Mailand und Berlin, könnten Sie endlos viele solcher Bilder produzieren, mittels derer man die Welt ebenfalls lesen könnte.
Tatsächlich ebnen sich die Unterschiede mit der Zeit ein. Man reist um die Welt und sieht immer nur andere Aspekte ein und derselben Geschichte. Ich bin im letzten Jahr mit Paulo Tavares in Amazonien gewesen, wo wir als Gäste des Guarani-Tribes vor Ort dokumentierten, wie brasilianische Farmer versuchen, in ihr Reservoir einzudringen, um das Land für den Anbau von Soja zu nutzen. Es handelt sich um eine Wiederholung der Kolonialgeschichte, nur dass dieses Mal andere Technologien und Gesetze angewendet werden. In diesem Sinne bin ich zwar einerseits am anderen Ende der Welt, aber doch nur, um dort festzustellen, dass ich dort Teil derselben Geschichte bin, da dort das Soja angebaut wird, das wir hier in Europa konsumieren — oder das in Genf an der Börse verkauft wird als digitale Ware. Man muss eigentlich nur meine Fotos von der Genfer Rohstoffbörse und vom Reservoir der Guarani nebeneinander stellen, und schon hat man eine Narration. Meine Fotos zeigen die Verknüpfungen der Welt und helfen uns im besten Fall, die sich daraus ergebenden Narrationen besser zu verstehen.
Wenn Ihre Bilder den Kontext so dringend benötigen, wie sehr wird dann beispielsweise das Layout eines Ihrer Kataloge zum Gegenstand der Erzählung? In Ihrem Buch „Transient“ standen Ihre Fotos ohne jede weitere Erläuterung auf weißem Grund. In „The Appearance of That Which Cannot be Seen“ ist jedes Bild mit gleich zwei Kommentarebenen versehen.
Auch das ist zurückzuführen auf ein Gespräch mit Bruno Latour. Er sagte, dass er die Bilder nicht auswählen könne, wenn er nur das Foto sähe. Er benötigte von mir Informationen. Ich begann ihm die Bilder persönlich zu erklären, die er sich bei mir im Studio angeschaut hat.
Ist das so erwähnenswert?
In meinem Falle schon. Ich war mein Leben lang schüchtern und zurückhaltend, was die Verbalisierung dessen anbetrifft, was ich fotografiere. Sie haben ganz zu Recht angemerkt, dass mein Buch „Transient“ seinerzeit ohne jede Textebene auskam. Ich habe als Jugendlicher sogar einmal bei Marcel Marceau einen Kurs über Mimik und Pantomimik gemacht…
Möge er in Frieden ruhen. Ich habe Marceau einmal interviewt. Er war neben Jean-Louis Barrault der größte Pantomime, der je gelebt hat!
Es ging mir eben lange Zeit und anders als Ihnen darum, alles mit visuellen Mitteln auszudrücken — statt mit Worten. Es gab dann ein Emanzipationsmoment, als es darum ging, im neuen Katalog mit den Bildunterschriften etwas auszudrücken, was eben nicht den typischen Photo Captions der Bildagenturen entsprach. Meine Kommentare ergeben zusammen mit den Kommentaren der jeweiligen Kuratoren eine Spannung zwischen dem jeweiligen Bild und den beiden Textkommentaren — und ein Deutungsfeld öffnet sich. Text und Bild bekommen dieselbe Wichtigkeit. Und übrigens war es auch wichtig, den Dialog mit den Grafikern Linda Van Deursen, Alina Schmuch und Jan Kiesswetter zu führen, mit denen ich das Konzept der Ausstellung entwickelte.
Gilt dieses Prinzip auch für Ihre kommende Ausstellung, die am 24. April im Ludwig Forum in Aachen eröffnet wird?
Wir haben uns heran getastet. Bereits meine Ausstellungen im Karlsruher ZKM und im Mailänder PAC drehten sich auch um die Frage der Präsentation. Wir wollten es vermeiden didaktisch zu sein, aber wir wollten auch die Hintergrundinformationen liefern, die zum Verstehen der Bilder nötig sind. Wir haben uns nach langen Überlegungen für eine Präsentation der Fotos entschieden, die an bewegliche Theaterkulissen erinnert. Auf diese Weise konnten wir die Ausstellung immer erweitern oder verknappen oder die Bilder in immer anderen Konstellationen, in Episoden oder in Akten, zeigen. Der Ausstellungsaufbau ähnelt der Abstraktion eines Gartens oder der einer Landschaft, also Orten, in denen es ebenfalls Verknüpfungen gibt.
Zunehmend zeigen Sie in Ihren Ausstellungen auch Ihre Filme. Reicht Ihnen das Foto nicht mehr aus in seiner ruhenden Zweidimensionalität?
Wie so oft spielte eine technische Entwicklung eine entscheidende Rolle. Es gab dieses Moment des Umbruchs, als die Canon-5D-Kamera sowohl Fotos als auch Filme schießen konnte. Die digitale Technik war mit einem Mal so leistungsstark und schnell, dass eine hochauflösende Kamera 25 Bilder pro Sekunde machen konnte — und die Bilder abermals das Laufen gelernt haben. Meinen Film „Alpi“ habe ich dagegen noch auf super16mm gedreht. Und nicht vergessen werden darf die Wichtigkeit des Tons: Die Tonspur macht vielleicht fünfzig Prozent eines Films aus.
Hat Ihre zunehmende Beschäftigung mit dem Medium Film auf die Fotografie bei Ihnen zurück gekoppelt?
Ich denke, dass sich das modulare Konzept meiner Ausstellungen direkt auf die Erfahrung des Filmschnitts zurückführen lässt. Die Mailänder, die Karlsruher und demnächst die Aachener Ausstellung arbeiten mit der Idee des Editings, wie man es vom Film kennt. Man kann diese Ausstellungen wie Storyboards im Film lesen. Audio-Informationen und Sequenzen von Bildern ergeben im Kopf des Betrachters neue Schnittfolgen, je nachdem wie man sich mit dem eigenen Körper durch die jeweilige Ausstellung bewegt.
Umgekehrt zeigt die erste Einstellung Ihres Films „Alpi“ ein indisches Filmteam, das vor der Kulisse der Alpen einen Bollywood-Film dreht.
In dem Film geht es um die Möglichkeit verschiedener Blickwinkel, wie wir die Alpen wahrnehmen können. Indem ich das indische Filmteam dabei mit der Kamera beobachte, wie es eine Filmszene vor Alpenpanorama dreht, zeige ich, wie die Alpen in der Welt des Bollywood-Kinos als eine sehr exotische Landschaft wahrgenommen werden. Einerseits exotisch, weil die Schweiz sowohl ein Wohlstandsparadies wie auch ein Naturparadies darstellt. Andererseits drehen indische Filmteams in den Alpen auch deshalb, weil die Kaschmir-Region, in der traditionell die Bergszenen der Bollywood-Filme gedreht werden, seit einigen Jahren eine Kriegsregion ist. Mit dieser Szene im Speziellen und mit dem Film „Alpi“ im Allgemeinen habe ich versucht zu zeigen, dass Landschaft immer codiert sein kann. Was für den einen die Heimat ist, ist für den anderen eine Phantasie, eine Projektionsfläche. Und deshalb sehen wir diese Verschiebung nicht zufällig gleich am Anfang des Films. Und somit wird auch klar, dass „Alpi“ eben nicht nur ein Film über die Alpen ist, sondern vor allem auch ein Film über die Globalisierung der Wahrnehmung von Landschaften.
Sie sind in Mailand geboren und aufgewachsen — im Angesicht der Alpen.
Genau, von Mailand aus ist es nur eine kurze Strecke bis zu den Alpen. Ich habe dieses Gebirge also seit meiner Kindheit sowohl als Heimat als auch als Projektionsfläche erlebt. Einen Film über genau diese Berge zu machen fühlte sich für mich ganz selbstverständlich an. Das zentrale Thema meiner Fotografie — was ist Oberfläche, und was verbirgt sich dahinter — konnte ich bei meinem ersten Film ungebrochen vom Foto ins Bewegtbild übertragen.
Und wie verhält es sich mit den anderen Themen, die sich wie ein roter Faden durch Ihre Fotografien ziehen — das Motiv der Naturinszenierung einerseits wie auch andererseits das Motiv der Eingriffe des Menschen in die Natur?
Wie Sie es bereits sagten: Das sind einige der Themen meiner Fotografie, ob sie sich nun ins Bewegtbild verlagert oder als Standbild auf Papier geprintet wird. In meiner Ausstellung geht es auch darum, diese Themen auszuweiten. Einerseits gibt es im „Alpi“-Film auch Aufnahmen aus dem Ski-Dubai-Center in Dubai — einer künstlich gekühlten Indoor-Skisprungschanze inmitten der Wüste Arabiens. Und andererseits bin ich im Zuge meiner Recherchen auf das Werk des Alpenkünstlers Giovanni Segantini gestoßen, der für die Weltausstellung 1900 in Paris ein gigantisches 360°-Alpenpanorama zu malen beabsichtigte, in welchem echtes Gras, echte Kühe und echte Geräusche das Gemälde von der Alpenlandschaft vervollständigen sollten. In gewisser Hinsicht war Segantini also ein Vordenker voll immersiver Erlebnisräume. Die Hoteliers des Engadin hätten Segantinis gigantische Installation finanzieren sollen, aber noch in der Planungsphase sprang ein wichtiger Geldgeber ab — und das gesamte Projekt blieb unvollendet. Wir könnten noch viel weiter zurück gehen, in das Zeitalter des Barock, als sich die Menschen für die Oper und die Künstlichkeit und die technischen Möglichkeiten der Oper zu begeistern begannen, um der echten Welt eine artifizielle Welt entgegenzusetzen. Gerne hätte ich auch das fotografiert, aber dafür wurde ich nicht nur zu spät geboren — auch gab es damals noch keine Fotoapparate, geschweige denn Filmkameras.
Interview: Max Dax
© Armin Linke, ReN_005446_31 CNR, National Research Council, Fermi conference hall, reproduction of the map made by Fra' Mauro in 1460 Roma Italy